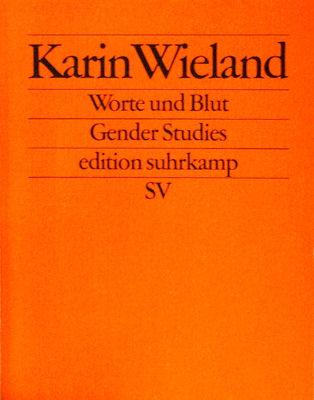
Worte und Blut.
Das männliche Selbst
im Übergang zur Neuzeit.
Frankfurt/Main:
Suhrkamp Verlag 1999
Meine Interpretation beruht nicht auf neu hinzugekommenen oder entdeckten Fakten, sondern ordnet das, was wir wissen, anders und neu. Die Einfachheit des Ordnungsschemas entspricht seiner grundlegenden Bedeutung. Das abendländische Streben nach männlicher Vervollkommnung verfängt sich einerseits in der Paradoxie von Worten und Blut und wird andererseits von ihr angetrieben. Mit dem Begriffspaar Worte und Blut wird eine historische Entwicklungspsychologie des männlichen Selbst nachgezeichnet, so wie sich in Europa von 1000 bis 1500 herausgebildet hat. Die Metamorphose beginnt mit der magischen Einheit in der Gestalt des gesalbten Königs, und sie endet in der nach den Wertsphären der Kunst, Wissenschaft und Politik differenzierten Männlichkeitstypologie der italienischen Renaissance. Der Gang der verschiedenen Koordinationen von Worten und Blut vollzieht sich über die ewige Wiederkehr des gleichen Problems: Worte, die das Blut zu überwinden suchen, aber immer wieder des Blutes bedürfen, um sich ihres Seinsgrunds zu vergewissern.
Bernhard von Clairvaux ist der Heilige aus der selbstgewählten Wüste, der die besinnungslose Hingabe in der Liebe zu Gott predigt und dessen Mönche begierig sind, seine erotischen Geschichten über die Jungfrau zu hören; sie sind durch ihn Ritter einer neuen Liebe geworden, der Liebe zu Maria. Bernhard ist der wortgewaltige Vertreter der Schweigsamkeit und eine aggressive politische Instanz des 12. Jahrhunderts. Seine hasserfüllten Worte gegen die Ungläubigen dröhnen durch dieses Jahrhundert, das gleichzeitig von seinen honigsüßen Liebesschwüren zur Mutter Gottes durchdrungen ist. Bernhard predigt das Einswerden mit dem Wort, die Meditiation in Stille und Abgeschiedenheit, die den Geweihten in eine ekstatische Verzückung bringt. Das eine Wort birgt für ihn den Abglanz der Herrlichkeit und die Erlösung wird dem Menschen durch das Blut Christi gewährt.
Abailard ist der aus der Stadt vertriebene Kleriker, der in der Arena des Geistes seine Widersacher mit seinem berüchtigtem Scharfsinn niedergestreckt hat. Die von ihm geführten Diskurse um die Bedeutung der Worte sind Diskurse, die bereits die neuen Sphären der Macht definieren. Für Abailard ist die Analyse des sprachlichen Ausdrucks die Waffe des Logos. Nicht das eine Wort, das nach innen führt, steht im Mittelpunkt seines Denkens, sondern das Verständnis des Satzes, die grammatikalische Konstruktion, das System der Worte, das Sinn macht. Für Abailard bergen die Worte den Zweifel und die Fragen, die uns zu Gott führen. Das Denken von Bernhard von Clairvaux und das Denken von Pierre Abailard strebt den Kathedralen gleich in die Höhe. Bernhards meditative Suche ist nach oben hin zu Gott gerichtet, der in einer ekstatischen Einswerdung dem Gläubigen einen Zustand der höchsten Klarheit und Konzentration gewährt.
Auch Abailards rationale Suche nach der Wahrheit ist nach oben hin gerichtet; er spitzt seinen Zweifel zu, er treibt ihn mittels seines Scharfsinns in die Höhe, so dass ihm Gott Einsicht in seine Geheimnisse zu gewähren vermag.
Von der einfachen zur reflektierten Differenz: Bernhard begeistert das Blut mit Worten; Abailard will aus den Worten die Spur des Blutes lesen. An die Ritter wenden sie sich beide: Abailard wird zum Ritter des Wortes, und Bernhard macht die Ritter zum Bestandteil seiner Liebe zur Mutter Gottes. Das gegenseitige Suchen und Finden der Wahrheit, das Bernhard und Abailard verbindet und trennt, ist geprägt vom Gleichgewicht der höchsten Spannung, das den abendländisch-christlichen Geist ausmacht.
Es war Francesco Petrarca ein leidenschaftlicher Wunsch, den antiken Autoren so nahe wie möglich zu sein. In seiner Studierstube, umgeben von den in Büchern niedergelegten lateinischen Worten seiner toten Freunde, schrieb er seine Dichterworte nieder, und im Kontakt mit den Größen der Antike verlieh er seinen Worten eine nachgeradezu kultische Weihe. Auf Latein zu schreiben bedeutete für Petrarca, seine Worte mit Unsterblichkeit zu versehen.
Francesco Petrarca gehört dem Adel des Wortes an. Er war der Prophet seiner selbst. Der Glanz seiner Dichterperson wird durch seine geschriebenen Worte erzeugt; es ist das Medium und der Gebrauch der Worte, die ihm den Glauben schenken, demselben Geist wie die Römer anzugehören, römisches Blut in den Adern zu haben. Die Worte bilden den Thron, von dem aus er den edlen Toten die Hand reicht und seinen Adel spürt. Doch die Gemeinschaft des lebenden mit den toten Männern in der Welt der lateinischen Worte bewahrte den Dichter nicht vor Angriffen seiner Sinnlichkeit, denn er war ein Mensch und ein Mann. Die niedrigste Art der Schönheit war für Petrarca die der schönen Körperlichkeit. Die Liebe zu einer schönen Gestalt erlebte er als einen Gegensatz zu der von ihm gesuchten Geistigkeit. Da er dem Adel des Wortes angehört, stellt sich für ihn die Frage des Blutes als Frage der Abstammung nicht. Doch im Zusammentreffen mit dem schönen anderen Geschlecht spürt er, dass er Blut in seinen Lenden hat. Laura gemahnt ihn an seine physische Existenz und dadurch an seinen Tod.
In der italienischen Sprache schreibt er seine Liebeslyrik. Als Dichter italienischer Worte will er sich nur rimatore und nicht poeta nennen lassen, da ein wahrer Dichter nur ein Dichter lateinischer Worte ist. Petrarca erschafft einen italienischen Wortkörper, in dem er die schöne, weibliche Gestalt, die sein Blut zu reizen vermag und ihn solcherart an seinen sterblichen Körper gemahnt, leben und sterben lässt. Durch das Schmieden von Versen in italienischen Worten, durch die Konstruktion nahezu unlöslicher Wortgebilde seiner Ruhmessucht und ihres Namens, durch die Verbindung der Heilsgeschichte mit seiner leidvollen Liebesgeschichte vereinigt er sich mit ihr, wird eins mit ihr im Wort. Der Dichter verleibt die schöne Frau, die ihn sein Blut spüren lässt, seinem selbstreferentiellen System der Worte ein, und die Worte, mit denen er sie erschafft und tötet, gehören dem Wortkreislauf an, der ihm Unsterblichkeit bescheren soll.